Reise(un)freiheit – Werke von Annemirl Bauer
- 31.05.2024 — 20.09.2024
- Annemirl Bauer
„Was machen dem Geist Mauern und Entfernungen aus!“ schrieb Annemirl Bauer Mitte der 1980er Jahre aus der DDR in einem Brief an ihre Tante in Westdeutschland. Reisen empfand die 1939 in Jena geborene Künstlerin als essenziell, um Eindrücke vom Leben in anderen Ländern zu sammeln, ihre politische Weltsicht zu schärfen und informiert ihre künstlerische Arbeit zu entwickeln. Annemirl Bauer studierte 1960-1965 an der Kunsthochschule Weißensee und schloss ihr Studium mit einem Diplom in der Fachrichtung baugebundene Kunst ab. Schon seit den 1950er Jahren führten sie Reisen unter anderem nach Frankreich, Polen, Spanien und in die damalige ČSSR. Doch die meisten ihrer Reisewünsche als Künstlerin blieben in der DDR unerfüllt und wurden abgelehnt. Der restriktiven Grenzpolitik der SED, die sie als „gewaltsame Eingrenzung eines ganzen Volkes“ beschrieb, begegnete Annemirl Bauer mit öffentlichem Protest. In einer sogenannten Eingabe von 1984 forderte sie die allgemeine Reisefreiheit für alle DDR-Bürger:innen:
„Die Eigenständigkeit meines Denkens und Handelns ist durch eine lebenslängliche gewaltsame Eingrenzung durch Nichtinformation und Isolation in zunehmendem Maße, so gut wie nicht mehr gewährleistet. Deshalb verlange ich dringendst die freie und ungehinderte Ein- und Ausreise für mich und meine Tochter und zweitens ein schriftlich fixiertes verbindliches Programm für die nächsten 3 Jahre, daß in dieser Zeit dieses selbstverständliche Recht des ungehinderten Reiseverkehrs für alle Bevölkerungsschichten möglich wird.“
Als Reaktion auf diesen Brief wurde die Künstlerin aus dem Verband Bildender Künstler (VBK) der DDR ausgeschlossen, was einem Berufsverbot gleichkam. Zu dieser Zeit war sie schon längst ins Visier des Ministeriums für Staatssicherheit geraten und wurde mit Repressionen sanktioniert, auch weil sie die Einführung der Wehrpflicht für Frauen in der DDR kritisierte und sich mit der inhaftierten Friedens- und Frauenrechtsaktivistin Bärbel Bohley solidarisierte. Die Staatssicherheit leitete „Zersetzungsmaßnahmen“ gegen Bauer ein, die sie sozial isolieren und psychisch destabilisieren sollten. Durch ihr Engagement wird Bauer in der Forschung zu jenen „Künstlerinnen der subkulturellen Öffentlichkeit“ gerechnet, die einen „aktive[n] Beitrag […] zum Widerstand und zur Friedlichen Revolution 1989“ (Dvorakk 2022, S. 85) leisteten.
Die politischen Ungerechtigkeiten, die Einschränkungen der Reisefreiheit und das Gefühl des Eingesperrtseins in der DDR sind in zahlreichen Werken der Künstlerin präsent. Mauern, Zäune und Gitter sind wiederkehrende Motive.
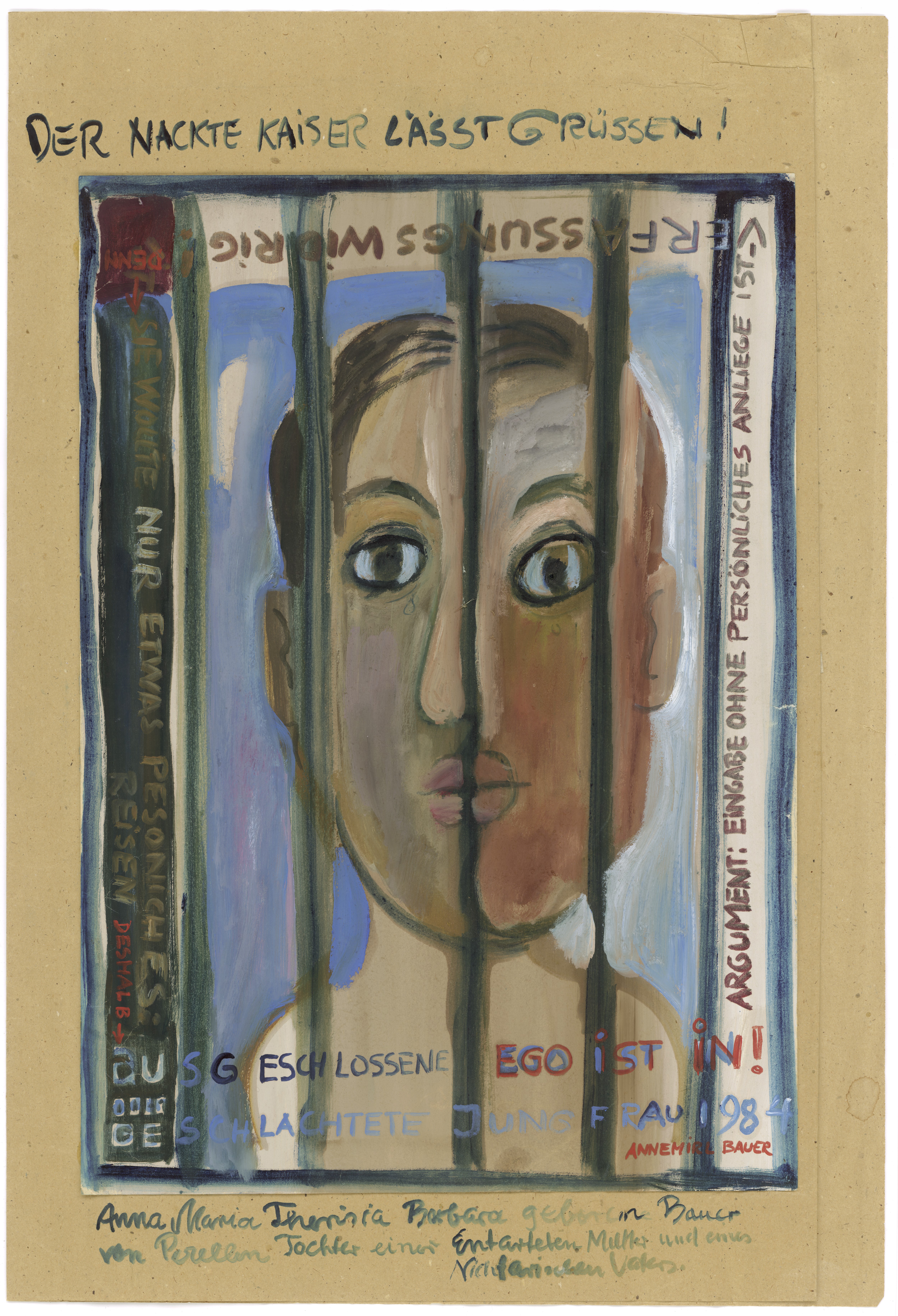
Ihre Situation brachte die Künstlerin in einem Selbstporträt hinter Gittern zum Ausdruck („Der nackte Kaiser“, 1984). Dort ist sie umgeben von Worten, die an eine Anklage vor Gericht erinnern: „Argument: Eingabe ohne persönliches Anliegen ist verfassungswidrig. Sie wollte nur etwas Persönliches: Reisen. Deshalb ausgeschlossene Egoistin! Die geschlachtete Jungfrau.“ Der Titel der Arbeit bezieht sich auf das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, eine Parabel auf Obrichkeitshörigkeit und Leichtgläubigkeit. Während einer Sitzung des VBK am 29. Juni 1984 hatte sie ihre Eingabe verteidigt. Ihre Rede hat sich in einem Protokoll erhalten: „Mein Anliegen geht doch alle an. Ich komme mir vor, wie bei ‚Des Kaisers neue Kleider‘“ (In meinem eigenen Lande 2012, S. 88), sagte sie dort.
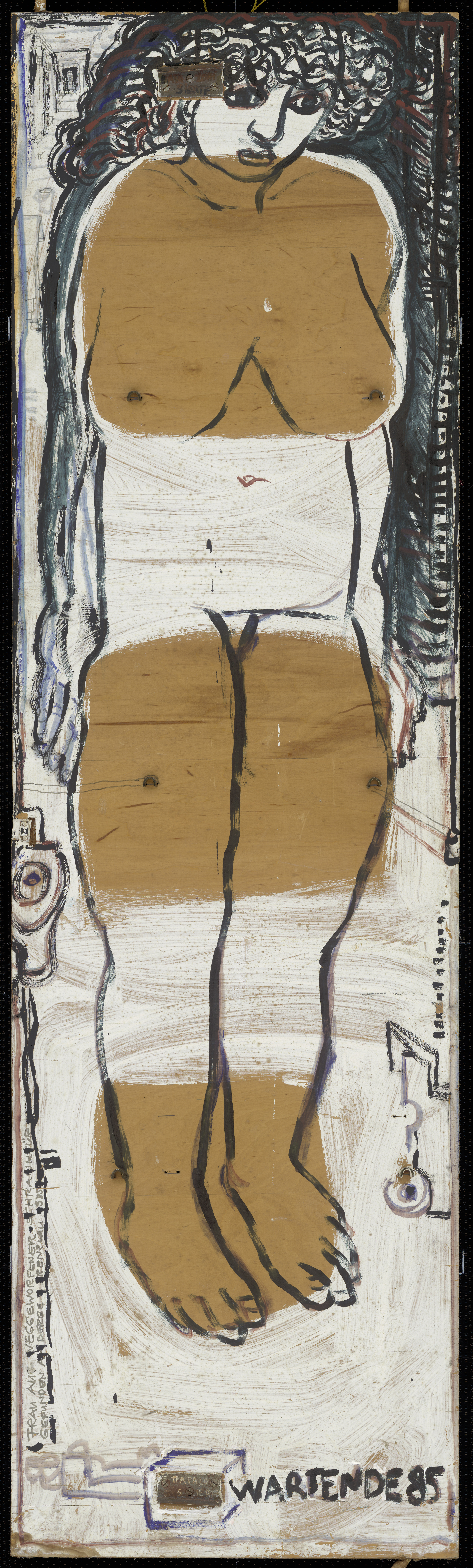
139,5 cm x 41 cm, Mischtechnik auf Holz. Mit freundlicher Genehmigung des Annemirl Bauer Haus und Archiv/Niederwerbig
Die Arbeit „Wartende“ (1985) zeigt einen nackten Frauenkörper mit gesenktem Kopf und traurigem Ausdruck. Die Arme liegen eng am Körper an, wie Einschnürungen ziehen sich Pinselstriche in weißer Farbe über Rumpf und Beine, so dass die Figur als mumienartige Kranke erscheint. Die Malerei wurde auf einer „weggeworfenen Schranktür“ ausgeführt, wie Bauer am Rand selbst vermerkt hat, ebenso wie die Bezeichnung „Patologisierte“. Das Format der Tür, ihr Format und ihre Materialität hat sich die Künstlerin mehrfach angeeignet und genutzt. Ihre schmale Hochkant-Form scheint den Körper regelrecht einzuzwängen, zwei Metallbeschläge werden zu Brustwarzen. Zugleich ist die Tür Metapher für eine Grenzsituation, spielt aber als „weggeworfener“ Gegenstand auch darauf an, dass Annemirl Bauer sich ausgegrenzt und abgestempelt fühlte – verdammt zum Warten auf eine Reisemöglichkeit.
Doch ebenso wie sie ihre ausweglose Situation in der DDR visualisierte, so wurde auch die Welt hinter der Mauer, die sie auf ihren Reisen erkundete, zum wichtigen Gegenstand ihrer Kunst. Dies wird vor allem in der Verarbeitung gefundenen Materials evident. Ausschnitte aus Zeitungen und bunten Zeitschriften, Briefmarken, Fahrpläne und Karten, Fundstücke vom Strand – alles wird kombiniert, collagiert, übermalt und mit Text kommentiert. In Sosopol an der bulgarischen Schwarzmeerküste, wo sie wiederholt hinreiste, hielt sie etwa Porträts der Bewohner:innen und landschaftliche Eindrücke in Materialcollagen mit Strandgut fest. Sie verarbeitete nicht nur die faszinierende Farbigkeit und Leichtigkeit ihrer Reiseerlebnisse, sondern auch die intellektuellen Anregungen und die Intensität der Selbstvergewisserung. Davon zeugen etwa ihre Selbstporträts auf Reisen wie auch Darstellungen von Frauen, die sie unterwegs traf.
Die Zusammenhänge von Kunst, Reisen und den verschiedenen Lebenswelten von Frauen beschäftigten Bauer vermutlich von Kindheit an. Durch familiäre Verbindungen hatte sie eine besonders enge Beziehung zu Frankreich, nicht zuletzt durch die Erinnerung an ihre weltgewandte Großmutter Rosa Bauer, die in Paris studiert hatte. In den 1950er und 1960er Jahren reiste Annemirl Bauer mehrmals nach Südfrankreich, meistens in Begleitung ihrer Mutter oder Freundinnen. Ihre Mutter, Tina Bauer-Pezellen (1897–1979), war ebenfalls Künstlerin und hatte sich in der Weimarer Republik kritisch mit sozialen Fragen auseinandergesetzt. Nachdem ihr Werk während des Nationalsozialismus als „entartet“ verfemt worden war, gewann sie in der Nachkriegszeit in der DDR Anerkennung. Mutter und Tochter besuchten in Frankreich eine entfernte Verwandte, die dort in einer protestantischen Schwesterngemeinde lebte. Ihre Begegnung mit den Schwestern von Pomeyrol beeindruckte die damals 15-jährige Annemirl Bauer nachhaltig, besonders der Kontakt zur Gründerin Antoinette Butte. Butte war in der Vorkriegszeit als Angehörige der Eclaireuses eine Schlüsselfigur in christlichen Frauenbewegungen und besonders für die sogenannten Girl Scouts (Pfadfinderinnen), die sich für ein körperliches und geistiges Empowerment von Frauen und Mädchen einsetzten. Butte brachte diese Werte in ihre Ordensarbeit ein.
Auch nachdem der Mauerbau das Reisen nach Westeuropa immens erschwerte, hielt Annemirl Bauer Briefkontakt zu den Schwestern. Erst 1977 erhielt sie endlich die Erlaubnis, erneut nach Frankreich zu fahren. Durch eine vorgetäuschte Krankschreibung gelang es ihr, den Aufenthalt auf fast einen ganzen Monat auszudehnen. Im Laufe ihres Lebens blieb die Ordensgemeinschaft für Annemirl Bauer ein wichtiger Bezugspunkt, um die Funktion von Kunst und Genderrollen zu diskutieren und das Zusammenleben von Frauen zu erleben. Die Schwestern tauchen immer wieder in ihren Werken auf. Auf eine Zeitungswerbung der Lufthansa etwa, die einen Flugzeugflügel unter gleißendem Sonnenlicht zeigt, hat sie eine Nonnenfigur gezeichnet und den witzigen Titel „Predigende Frau in der Wüste“ (1987) hinzugefügt. Den biblischen Prediger in der Wüste, dessen Warnungen nicht gehört werden, verwendet sie als Metapher für die klugen Frauen, denen kein Gehör geschenkt wird.
Neben der Ordensgemeinschaft zog auch die besondere Natur und Atmosphäre Annemirl Bauer nach Frankreich. Sie beschrieb retrospektiv in einem Interview: „Das weiße Licht in Südfrankreich und die trockenen [...] Luft [lassen] die Dinge direkter und farbiger erscheinen und geben ihnen eine greifbare Plastizität.“ (In meinem eigenen Lande 2012, S. 108) Abseits der Landschaften faszinierte die Künstlerin auch das pulsierende Stadtleben in Paris. Sie beschrieb in vielen Briefen an ihre Tochter Amrei ihre Freude am Erlebnis der bunten, vollen Großstadt. Wichtig war für sie vor allem auch der Besuch Pariser Museen, um ihre Auseinandersetzung mit Originalen zeitgenössischer Kunst zu intensivieren. Durch die Betrachtung von Werbung und Statuen im Stadtraum schärfte sie zudem ihren kritischen Blick auf Darstellungen von Frauen und Männern. Ihr erster Parisbesuch erschien Bauer wie ein Traum, sie fühlte sich wie berauscht durch ihre Eindrücke der Architektur, der Menschen, der ganz anderen Lebenswelten als in der DDR. Bei ihren Streifzügen durch die Stadt sammelte sie neben unzähligen notierten Beobachtungen auch Material aller Art, Prospekte, Eintrittskarten, Zeitschriften. Ihre Fundstücke arrangierte sie mit Zeichnungen und Fotografien zu Collagen. Das Gefühl des traumhaften Rausches ist besonders in der Collage „Ich in Paris/Begrüßung in Paris“ spürbar, die sie nach ihrer letzten, hart erkämpften Frankreichreise 1987 anfertigte: Hier imaginiert sich Annemirl Bauer in einem Saal voller Menschen, die begeistert applaudieren. Das Bild eines Publikums ist einer französischen Zeitung entnommen. Das Papier hat sie so aufgerissen, dass ihr dahinter angebrachtes Porträtfoto erscheint. Mit Tusche hat die Künstlerin sich eine Lockenfrisur mit aufwendigem Haarschmuck, ein wallendes Kleid und schicke Absatzschuhe dazugezeichnet, die unten zum Vorschein kommen, als würde sie sich hinter einem Vorhang hervorschieben. Sie scheint über den Zuschauer:innen zu schweben, mit weit ausgebreiteten Armen und einem breiten Lächeln auf dem Gesicht genießt sie die Aufmerksamkeit.
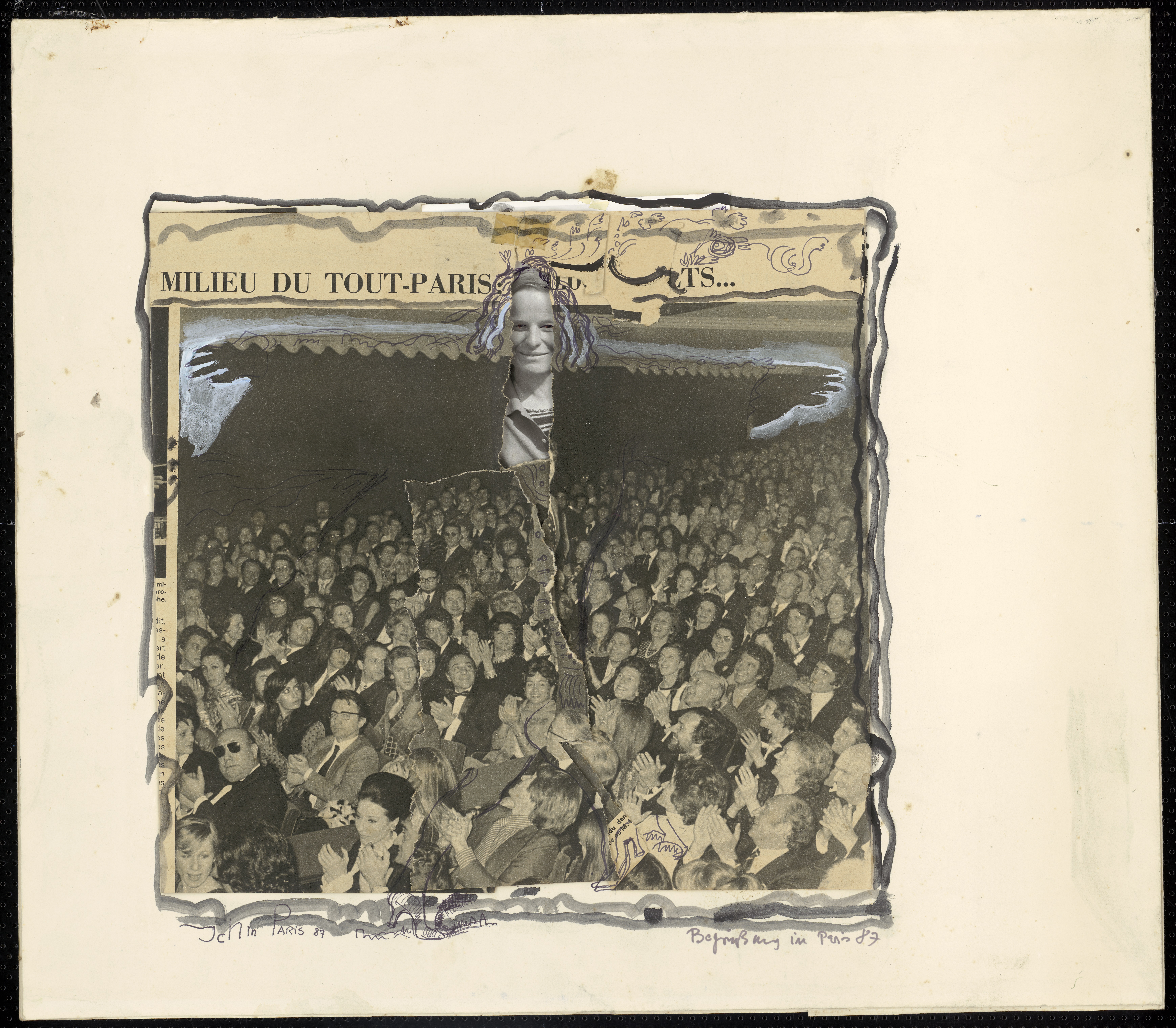
48 cm x 56,4 cm, Collage mit Skribent, Tusche, Gouache. Mit freundlicher Genehmigung des Annemirl Bauer Haus und Archiv/Niederwerbig
Ein weiteres Selbstporträt, gezeichnet auf einem Pariser Stadtplan in zarten Linien und bunten Farben, zeigt sie eingerahmt von Pin-Up-Girls. Unten hat sie notiert: „Schwestern aller Nationen vereint euren Sinn, euren Mut!“ In vielen ihrer Werke kommentierte Annemirl Bauer die Rolle von Frauen in der DDR, aber auch in anderen Ländern, und kritisierte dabei etwa sexuelle Gewalt oder die Unsichtbarkeit von Frauen in Geschichtsbüchern. Ihr künstlerisches Werk ist durchzogen von der Frage ihrer eigenen Position als Frau und Künstlerin in der patriarchalen Gesellschaft, die die DDR trotz der propagierten Gleichstellung von Männern und Frauen im Sozialismus war.
In vielen Arbeiten von Bauer werden Monumente oder Gebäude zu phallischen Symbolen. Diese häufig zunächst humoresk anmutenden Darstellungen bergen oft auch eine schmerzhafte Wahrheit. So visualisiert sie in „Männliche Architektur/Männliche Sicherheit“ (1987) die Verbindungen, die sie zwischen staatlichen Institutionen wie jenen der Sicherheitsorgane und der Architektur sieht. Von wem sind Politik und Stadtbild geprägt und für wen gedacht? - scheint die Künstlerin zu fragen. Wer bewegt sich auf welche Weise durch den Raum? - und wer kann sich darin sicher fühlen? Auf einer Collage aus braunem Papier mit vereinzelt angebrachten Zeitungsausschnitten konturiert ein lockerer Pinselstrich in schwarzen Umrissen einen Körper. Häuser und Türme auf den Zeitungsschnipseln werden dabei zu männlichen Körperteilen. Eines der Augen dieser männlichen Figur wird durch einen Frauenkopf auf einer aufgeklebten Fotografie gebildet. Die Frau erscheint im Hintergrund zwischen dem ersten Sekretär der SED, Erich Honecker, und einem Funktionär oder Soldaten. Die Männer schütteln sich an der Frau vorbei die Hände, wie in beschlossener Sache.

91 cm x 60,5 cm, Gouache auf Zeitung, auf Papier. Mit freundlicher Genehmigung des Annemirl Bauer Haus und Archiv/Niederwerbig
Auf ihren Reisen kam Annemirl Bauer außerdem mit Publikationen westdeutscher Feministinnen in Kontakt. So wurde vor allem die Zeitschrift Emma für Bauers Zugang zu feministischen Fragestellungen in der eigenen Kunst und der Kunstgeschichte wichtig. Sie nahm sogar auf der Suche nach Austausch mit der Emma-Redaktion Kontakt auf und schrieb: „Ich möchte euch schreiben, wie ich zu einer feministischen Haltung kam [...] meine zeitweilige Sprachlosigkeit, wie ich über die Kunst feministische Probleme verarbeiten möchte [...].“ (Im eigenen Lande 2012, S. 80) Um jene „Sprachlosigkeit“ zu überwinden, beschäftigte sich Annemirl Bauer mit der feministischen Linguistik der Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch. Deren These des Deutschen als „Männersprache“ griff Annemirl Bauer in ihren Werken zum Beispiel in Form von Wortspielen auf.
Im Jahr 1987 konnte Annemirl Bauer zum letzten Mal reisen, nachdem sie im Jahr zuvor durch die Fürsprache mehrerer Künstlerkolleg:innen wieder in den Verband aufgenommen worden war. Neben Frankreich reiste sie über Umwege außerdem illegal auf die spanische Insel Gran Canaria. Zu dieser Reise sind mehrere Zeichnungen entstanden. Ein wiederkehrendes Motiv sind Palmenhaine hinter Mauern, die sie dort sah und in den Zeichnungen nicht ohne Humor mit der Berliner Mauer parallelisierte. Auf einer dieser Blätter spring ein Männlein mühelos über die Mauer. Eine Schärpe bezeichnet ihn als FDJ-Sekretär, in der Hand trägt er ein „Devisenköfferchen“, das seine privilegierte Position unterstreicht.
Den Fall der Berliner Mauer im November 1989 hat Annemirl Bauer nicht mehr erlebt. Im August war sie an einer Krebserkrankung verstorben. Bärbel Bohley äußerte sich in einem Dokumentarfilm: „Wenn ich jemandem gegönnt hätte, dass er noch erlebt, dass die Mauer offen ist, dann Annemirl. Weil die so reiselustig war [...] Sie war wirklich ihr ganzes Leben lang so ein Vogel, der gegen den Käfig fliegt.“
Die Ausstellung REISE(UN)FREIHEIT - WERKE VON ANNEMIRL BAUER wurde im Rahmen des Forschungsprojektes „Affektive Archive. Auslandsreisen von Künstler:innen zur Zeit der DDR“ an der Technischen Universität Dresden von Prof. Dr. Kerstin Schankweiler, Jule Lagoda und Nora Kaschuba erarbeitet, in Kooperation mit Gwendolin Kremer von der Kustodie der TU Dresden und Amrei Bauer, Annemirl Bauer Haus und Archiv / Niederwerbig.
Gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung.
Literatur:
Elisaveta Dvorakk: Widerstand, Aktivismus und feministische Kunst der subkulturellen Öffentlichkeit der DDR. (Un-)Sichtbarkeiten – Desidentifizierungen – Visionen, in: Karin Aleksander et al.: Feministische Visionen vor und nach 1989. Geschlecht, Medien und Aktivismen in der DDR, BRD und im östlichen Europa, Opladen 2022, S. 83-111.
Kristina Volke (Hg.), In meinem eigenen Lande: die Malerin und Dissidentin Annemirl Bauer, Ausstellungskatalog Deutscher Bundestag, Berlin 2012.
